

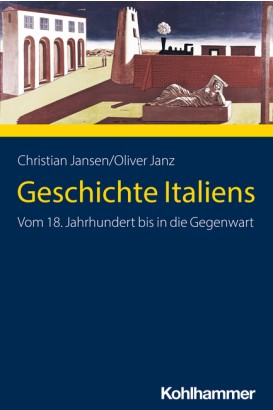
Reviewer Pascal Oswald - Universität des Saarlandes
CitationDeutschsprachige Überblicksdarstellungen zur neueren Geschichte Italiens sind rar. Wer eine solch umfassende und übergreifende Darstellung suchte, musste bisher auf Rudolf Lills 1988 erschienene Geschichte Italiens in der Neuzeit mit ihrer katholisch-konservativen Ausrichtung oder auf die betreffenden Beiträge in der Geschichte Italiens (W. Altgeld u.a. [Hrsg.], Geschichte Italiens, aktualisierte und erweiterte Auflage 2016) zurückgreifen. Daneben lagen mit den Studien Hans Wollers zum 20. Jahrhundert (2010), Wolfgang Schieders zum italienischen Faschismus (2010), Friederike Hausmanns zu Italien nach 1943 (2006) und zuletzt Gabriele B. Clemens’ zum Risorgimento Arbeiten (2021) vor, die sich begrenzteren Zeiträumen widmeten.
Umso erfreulicher ist, dass mit Christian Jansen und Oliver Janz zwei Experten 2023 eine Geschichte unseres «fernen Nachbarn» (C. Dipper) vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart vorgelegt haben. Die Darstellung beginnt 1748, dem Jahr des Friedens von Aachen, der den Österreichischen Erbfolgekrieg beendete, und schließt mit dem Wahlsieg der Fratelli d’Italia 2022. Auf knapp 400 Seiten führen die beiden Autoren Leserinnern und Leser souverän durch die sogenannte französische Zeit, das Risorgimento, das liberale Königreich Italien, den Faschismus und die Republik Italien. Schwerpunkte liegen dabei klassischerweise auf der politischen und Wirtschaftsgeschichte. Nicht selten werden vergleichende Betrachtungen insbesondere zur deutschen Geschichte eingeflochten. Bei der Lektüre hat man den Eindruck, dass die Darstellung umso detaillierter wird, je mehr sie sich der Gegenwart nähert: Während die über 130 Jahre von der französischen Revolution bis zum «Marsch auf Rom» auf circa 130 Seiten abgehandelt werden, sind den folgenden rund 100 Jahren fast 200 Seiten gewidmet. Der Teil zur Republik Italien, bei dem sich das Autorenteam auf Jansens inzwischen vergriffene Monographie Italien seit 1945 stützen konnte, erscheint dem Rezensenten besonders gelungen. Ein «Epilog» (S. 337-345) mit sehr erhellenden Überlegungen zur politischen Kultur Italiens, welche Jansen und Janz von Klientelismus und trasformismo, einer ausgeprägten Distanz im Verhältnis zwischen Bürgern und Staat, einer Tradition gegen das staatliche Gewaltmonopol sowie starken lokalen Identitäten geprägt sehen, rundet den Band ab.
Die Menge an ausgewerteter Literatur ist beeindruckend, wenn auch freilich nicht erschöpfend. Insbesondere in das Kapitel über den Faschismus, das sich vorwiegend auf angloamerikanische und deutsche Arbeiten stützt, hätten mehr Spezialstudien eingearbeitet werden können[1]. Der Band enthält Urteile, die den Bewertungen älterer deutscher Überblickswerke diametral gegenüberstehen: Während Lill den vom faschistischen Italien 1935 entfesselten Abessinienkrieg noch 2016 als «anachronistischen Kolonialkrieg»[2] bezeichnete, räumen Jansen und Janz mit solchen Mythen auf, wenn sie – auf Basis jüngerer Forschungen – vom «ersten faschistischen Vernichtungskrieg» (A.-W. Asserate, A. Mattioli) sprechen. Bisweilen hätte sich der Rezensent jedoch gewünscht, dass die Autoren präziser solche historiographischen Entwicklungen und damit zusammenhängende Kontroversen (etwa auch eine Problematisierung der älteren Thesen Rosario Romeos, Denis Mack Smiths und Renzo De Felices oder allgemeinere Betrachtungen über den «Ort» des Risorgimento und des Faschismus in der Geschichte Italiens) erläutert sowie Desiderate für zukünftige Forschungen aufgezeigt hätten.
Zudem sind ein paar wenige kleine sachliche Fehler anzuzeigen, die sich in einer solch breiten Überblicksdarstellung wohl kaum vermeiden lassen[3].
Von diesen marginalen und gewiss subjektiven Kritikpunkten abgesehen, bietet das Buch eine beeindruckende Synthese sowie eine vorzügliche und gut lesbare Einführung in die neuere Geschichte Italiens. Es wird sicherlich zu einem neuen Standardwerk für all diejenigen avancieren, die sich in Deutschland mit diesem Thema näher befassen wollen.
[1] So fehlen etwa Hinweise auf Adriano Viarengos neue Cavour-Biographie, auf Carmine Pintos Buch über den brigantaggio, auf Roberto Vivarellis Storia delle origini del fascismo, auf Roberto Bianchis Il 1919 in Italia, auf die Werke Simona Colarizis und Aurelio Lepres oder auf Charles F. Delzells und Santo Pelis Bücher zur Resistenza.
[2] R. Lill, Das faschistische Italien (1919/22-1945), in W. Altgeld u.a. (Hrsg.), Geschichte Italiens, Stuttgart, Reclam, 2016, 3., S. 392-454, hier S. 423.
[3] So wurde der Partito Fascista Repubblicano nicht erst im November 1943 (S. 197), sondern bereits im September 1943 gegründet. Außerdem wäre dem Rezensenten neu, dass General Eisenhower das Unternehmen «Giant 2», das die Landung allliierter Fallschirmjäger in Rom vorsah, deshalb abgebrochen und den Waffenstillstand bereits am Abend des 8. September 1943 verkündet hätte, weil die nationalsozialistische Führung vom Waffenstillstandsabkommen erfahren und daher in einer Kommandoaktion die Flughäfen Roms besetzt hätte (S. 191).