

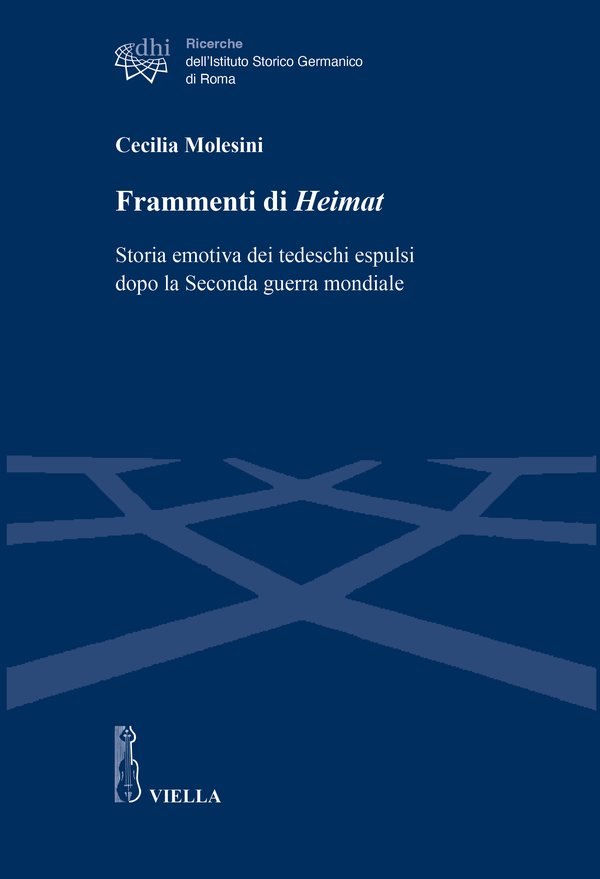
Reviewer Emilia Hrabovec - Comenius University Bratislava
CitationGegen Ende des Zweiten Weltkriegs und in den unmittelbaren Nachkriegsjahren flohen über zwölf Milionen Deutsche aus ihren Heimatgebieten im Osten oder wurden von dort vertrieben, die meisten in die zerstörten und überbevölkerten westlichen Besatzungszonen Deutschlands. Flucht, Vertreibung und Integration wurden somit zum existentiellen Grunderlebnis für Millionen Betroffene, aber auch zum grundlegenden Faktor im Leben der jungen Bundesrepublik, der bald auch eine große Aufmerksamkeit der Historiker fand.
Während sich die Geschichtsschreibung über die Integration der Vertriebenen anfangs auf politische und ökonomische Aspekte konzentrierte, wurden später, vor dem Hintergrund der sich wandelnden gesellschaftlichen Kontexte und wissenschaftlichen Trends, sozial-, kultur- und schließlich emotionsgeschichtliche Zugänge präferiert. Diesen innovativen Zugang hat auch die Autorin gewählt, um die Emotionsgeschichte der aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien vertriebenen evangelischen Deutschen zu rekonstruieren. Die Fokalisierung auf die deutschen Ostprovinzen, die auch vor dem Krieg Bestandteil des Deutschen Reichs gewesen waren, sowie auf die Evangelischen, die in Ostpreußen und Pommern die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung darstellten und deren Wahl auch durch die Quellen gegeben war, sind legitim. Im Falle des mehr als zur Hälfte katholischen Schlesiens hätte allerdings ein überkonfessioneller Vergleich interessante Einblicke bieten können.
Molesinis Untersuchung basiert auf aussagereichen, wissenschaftlich zum ersten Mal ausgewerteten „Ego-Quellen” (Rundbriefe und Korrespondenzen der evangelischen Pastoren, Tagebücher, Erinnerungen) und einem originellen interdisziplinären Zugang, der die quellengestützte emotionsgeschichtliche Perspektive und die Geschichte „von unten” mit der auf der Grundlage der wissenschaftlichen Literatur zusammengefassten politischen Geschichte verbindet. Mit diesem Instrumentarium rekonstruiert die Autorin die wechselvolle Geschichte der emotionalen Aufarbeitung der erzwungenen Migration und die schrittweise innere Akzeptanz des Vertreibungsschicksals und der Integration in die bundesdeutsche Gesellschaft.
Den roten Faden der Darstellung stellt die Bemühung dar, den offiziellen, oft politisierten Diskurs „über” die als Monolith angesehenen Vertriebenen und deren Emotionen und Wünsche durch den „von unten” geführten Diskurs „unter ihnen” zu revidieren, der sie selbst zum Wort kommen lässt, um zu zeigen, wie sie ihre Emotionen erlebten und artikulierten.
In der Konfrontation der beiden Ebenen identifizierte die Autorin drei verschiedene Phasen der emotionalen Erfahrung der Vertriebenen. Zum einen die Phase des „Verlassens”, die unmittelbar auf den Verlust der Heimat folgte und durch die Gefühle der Angst, des erlittenen Unrechts, das als größer empfunden wurde als jenes, mit dem die übrigen Deutschen den verlorenen Krieg zu bezahlen hatten, durch Ressentiments gegenüber den Polen/Russen sowie den mit der Vertreibung einverstandenen westlichen Alliierten, aber auch die Hoffnung geprägt war, bald eine sichere Bleibe zu finden und sich mit den Familienangehörigen zu vereinen. Diese von allen Vertriebenen geteilten Grundemotionen ließen eine „emotive Dachgemeinschaft” entstehen, die sie von den übrigen Staatsbürgern unterschied.
Die zweite Phase der „Anerkennung” wird durch die Übereinstimmung zwischen den Emotionen der Vertriebenen und ihrer „emotiven Dachgemeinschaft” sowie dem „emotiven Regime” der jungen Bundesrepublik charakterisiert, die legislative und wirtschaftliche Maßnahmen ergriff, um die Vertriebenen zu integrieren und ihre Kultur zu pflegen, die aber, so Molesini, durch die Übernahme des Opfernarrativs der Vertriebenen auch ihre eigene politische Verortung im antikommunistischen westlichen Lager zu begründen und die Schuld und Verantwortung für die Untaten des NS-Regimes auszubalancieren suchte. Molesini analysiert die wechselvolle, durch Frustration, Marginalisierung und Nostalgie, aber auch Hoffnung auf Besserung charakterisierte Geschichte der Integration und bestätigt die Befunde der neueren Historiographie, die das ältere Bild der raschen politischen und wirtschaftlichen Integration mit dem Hinweis auf das lange fortwirkende Gefühl der Fremdheit und Marginalisierung relativiert. In diesem Kontext schreibt Molesini die zentrale Rolle den „kleinen Emotionsgemeinschaften” zu, in denen die ehemaligen evangelischen Gemeinden ihre Erinnerung und Kultur pflegten, ihre Nostalgie und Sehnsüchte, aber auch ihre Gegenwart teilten und dadurch die alte Identität bewahrten, sich aber zugleich allmählich vom „Sitzen auf den Koffern” loslösten und der Integration in das reale Umfeld öffneten.
Dank dem großzügig entworfenen chronologischen Rahmen, der die Darstellung bis in die Siebzigerjahre fortführt, identifiziert die Autorin auch eine dritte Phase der „inneren Abkoppelung”, die sich vor dem Hintergrund der détente und der Ostpolitik abspielte und in der die „emotionale Dachgemeinschaft” immer weniger Relevanz besaß, die Distanz zwischen den Vertriebenen und ihren politischen Vertretern (Landsmannschaften) immer größer wurde und das zentrale Konzept der Heimat sich von einem auch mit politischen Inhalten gefüllten Ort, an den man zurückzukehren hoffte, zu einer „Heimat im Herzen” wandelte, deren Schönheit erinnert und deren Kultur gemeinsam mit der Erinnerung an die eigene unbeschwerte Jugend gepflegt wurde, ohne deren reale Veränderung und politische Unerreichbarkeit zu verkennen.
Obgleich die Emotionsgeschichte als Ausdruck der aktuellen Hochschätzung von Gefühlen methodologisch noch Unklarheiten birgt, bietet sie, wie das Buch von Cecilia Molesini beweist, ein Instrumentarium an, das über die Analyse der emotionalen Verfasstheit einer Gesellschaft wertvolle neue Erkenntisse liefert. Etwas flacher fiel dagegen die anhand der Literatur erarbeitete Vorstellung des politischen, sozio-kulturellen und vor allem kirchlich-religiösen Kontextes mit seinen zentralen moraltheologischen Fragen und deren emotionaler Erarbeitung, die sich aufgrund der Quellen (Pastorenbriefe) beinahe angeboten hätte. Dennoch bleibt es ein erfrischend geschriebenes und bereicherndes Buch.