

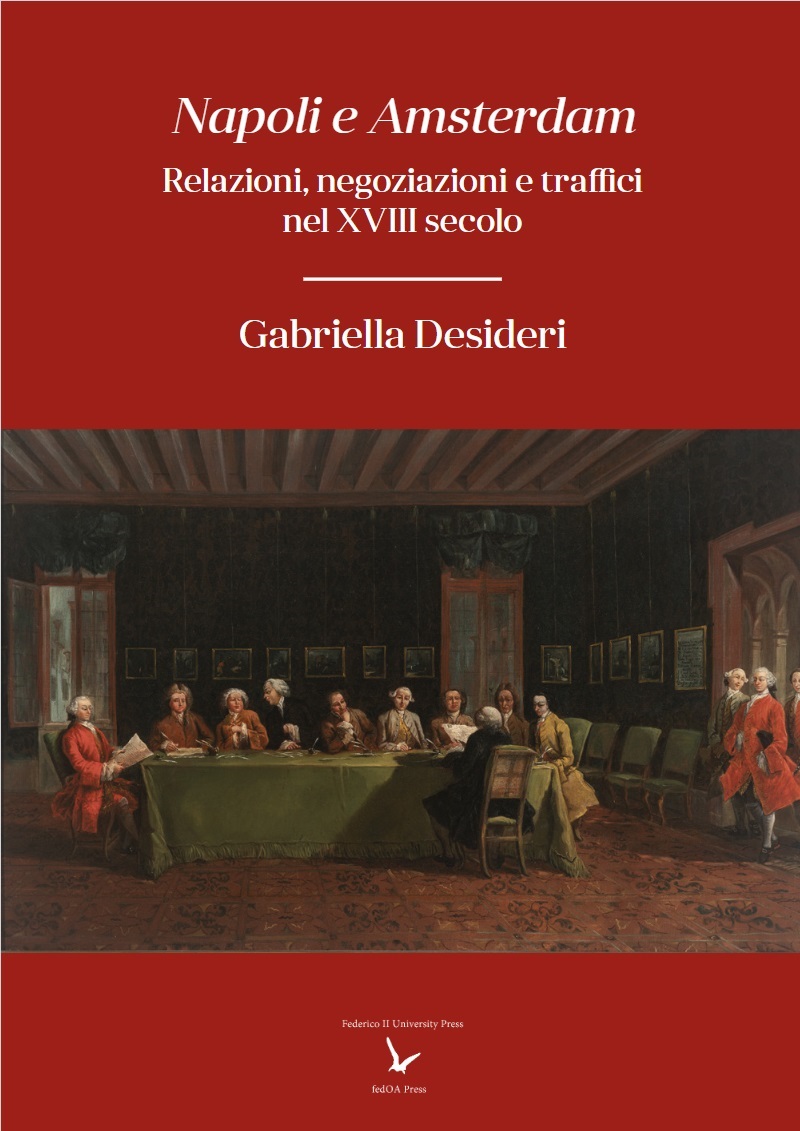
Reviewer Roberto Zaugg - Universität Zürich
Citation1734 eroberten die spanischen Bourbonen das Königreich Neapel. Das Territorium, das lange als spanisch-habsburgisches (1503-1507) bzw. österreichisch-habsburgisches Vizekönigreich (1707-1734) regiert worden war, wurde allerdings nicht zu den Besitzungen Philipps V. zugeschlagen. Stattdessen erlangte es die Unabhängigkeit unter dessen Sohn Karl von Bourbon, der zugleich auch König von Sizilien wurde. Mit dieser Wende erhielten Reformbestrebungen, die bereits unter den Österreichern Gestalt angenommen hatten, neuen Auftrieb. Zentrales Anliegen waren dabei die wirtschaftliche Entwicklung sowie die internationale Anerkennung der neapolitanischen Krone als eigenständiger Akteur. Zu diesem Zweck handelte die neue Dynastie sogenannte «Handels- und Navigationsverträge» aus, durch welche die Voraussetzungen für das Wachstum des Aussenhandels geschaffen werden sollten. Nach entsprechenden Abkommen mit Konstantinopel, Tripolis, Stockholm und Kopenhagen, kam es – nach rund fünfzehnjährigen Verhandlungen – 1753 auch zu einem Durchbruch mit Den Haag.
Das Buch von Gabriella Desideri bietet erstmals eine umfassende Rekonstruktion der neapolitanisch-niederländischen Beziehungen in den Bereichen der Diplomatie und des Fernhandels. Es erfüllt dadurch erfreulicherweise ein seit langem festgestelltes Forschungsdesiderat. Anders als im Titel angedeutet, behandelt die Autorin dabei nicht nur das 18. Jahrhundert, sondern gibt auch konsistente Einblicke in das 17. Die wichtigsten Quellen ihrer Arbeit sind diplomatisch-konsularische Korrespondenzen, Regierungsakten sowie die Hafenregister Neapels. Desideris Werk wird verdienstvollerweise durch zahlreiche Tabellen und Graphiken sowie durch einen reichhaltigen Anhang (Quellentranskriptionen, Listen zum diplomatisch-konsularischen Personal, Tabellen zum niederländischen Schiffsverkehr im Hafen Neapel) ergänzt.
Niederländische Schiffe waren bereits seit den 1590er Jahren in grossem Umfang in italienischen Häfen präsent – trotz des Achtzigjährigen Krieges auch in den spanisch dominierten Territorien. Mit dem Frieden von Münster (1648) wurden diese Beziehungen normalisiert. Die Vereinigten Niederlande eröffneten Konsulate in Süditalien und erhielten dort – wie auch in Spanien selbst – den Status der meistbegünstigten Nation. Dadurch kamen die Niederländer automatisch in den Genuss aller Rechte, die Angehörigen von Drittstaaten zugesprochen worden waren bzw. künftig zugesprochen wurden. Mit dem Pyrenäenfrieden (1659) und dem Vertrag von Madrid (1667) wurde dieser Status später auch den Franzosen bzw. den Engländern zuerkannt. Die drei Mächte aus Nordwesteuropa verfügten so in den beiden süditalienischen Territorien über vorteilhafte Rechtsdispositive. Die Etablierung leicht beeinflussbarer Partikularrichter für die Angehörigen dieser Nationen und die faktische Befreiung ihrer Schiffe von Zollkontrollen entzogen niederländische, französische und englische Kaufleute weitgehend der Kontrolle durch lokale Institutionen. Während Einheimische mit Zollkontrollen und kostspieligen Gerichtsverfahren rechnen mussten, konnten diese meistbegünstigten Ausländer zu weitaus vorteilhafteren Bedingungen Handel treiben und ihre ohnehin schon starke Marktposition weiter konsolidieren. Den neapolitanischen Reformern, die nach 1734 bessere Voraussetzung für die eigenen Kaufleute schaffen wollten, um einen «aktiven» (d.h.: mit eigenen Schiffen betriebenen) Aussenhandel anzukurbeln, waren diese Asymmetrien ein Dorn im Auge. Sie stellten sich auf den Standpunkt, dass die von Spanien geschlossenen Verträge keine Gültigkeit mehr hatten: Karl von Bourbon habe seine Territorien militärisch erobert und so ipso facto alle vorherigen Verpflichtungen der eroberten Gebiete annulliert. Frankreich und Grossbritannien zeigten unbeeindruckt: Sie weigerten sich, auf das neapolitanische Begehren einzugehen und neue Verträge auszuhandeln. Neapel verfügte schlicht nicht über die notwendige Kriegsmarine, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Zwar gelang es den Neapolitanern, die Partikulargerichtsbarkeiten der privilegierten Ausländer graduell auszuhöhlen, doch wagten sie es letztlich nicht, französische und britische Schiffe regulären Zollkontrollen zu unterwerfen.
Die Vereinigten Niederlande, die geschwächt aus dem Österreichischen Erbfolgekrieg hervorgegangen war, knickten hingegen ein. Vor dem Hintergrund ihrer militärischen Vulnerabilität gegenüber Frankreich und einer akzentuierten Konkurrenzsituation gegenüber Grossbritannien schien es den Generalstaaten vernünftig, durch ein bilaterales Abkommen ihre Position in Süditalien abzusichern. Man wollte nicht riskieren, dass Neapel – von der niederländischen Fragilität profitierend – unilaterale Schritte unternahm. Die Republik anerkannte mit dem Vertrag die (bereits vollzogene) Abschaffung der Partikularrichter und nahm Zollkontrollen in Kauf. Zugleich sicherten sich die Niederländer vorteilhafte Zölle, Toleranzmargen im Bereich der Religionsausübung sowie die Zusage, dass die Behörden nur in beschränktem Masse Durchsuchungen niederländischer Privatmagazine durchführen würden.
Der Vertrag war für Neapel vor allem ein diplomatischer Erfolg. In wirtschaftlicher Hinsicht konnte er den bereits begonnen Abwärtstrend des niederländischen Seehandels nicht abwenden. Liefen am Ende des 17. Jahrhunderts noch jährlich um die 120 Schiffe Neapel an, waren es in den 1780er Jahren nur noch rund 60. Neapel war keine Ausnahme: vielmehr spiegeln diese Zahlen eine allgemeine Tendenz des niederländischen Mittelmeerhandels im 18. Jahrhundert wider, der durch wiederholte Kriege mit Algier, welche die Versicherungskosten in die Höhe schnellen liess, und durch die französische und britische Konkurrenz eine nachhaltige Kontraktion erlitt. Die Handelsstruktur blieb indes konstant: niederländische Schiffe exportierten aus Süditalien mehrheitlich billige und voluminöse Rohstoffe (Salz, Olivenöl, Getreide), während sie eine Vielzahl an (mehrheitlich europäischer) Textilien sowie unterschiedliche «Kolonialwaren» importierten. (Wobei man korrekterweise die eigentlichen Kolonialwaren aus den Amerikas und aus gewissen asiatischen Regionen von anderen Waren unterscheiden müsste, die auf nicht kolonisierten asiatischen Märkten erworben wurden). Die Stadt Neapel war zwar ein grosser Absatzmarkt, blieb allerdings für die Niederländer im Vergleich zu Genua und Livorno von zweitrangiger Bedeutung. Eine niederländische Präsenz vor Ort entwickelte sich kaum – vielmehr wurde der Handel durch Schiffskapitäne oder durch reformierte Kaufleute aus der Schweiz abgewickelt, die z.T. auch als niederländische Konsuln agierten. Umgekehrt kam in Amsterdam auch keine neapolitanisch-sizilianische business community auf. Desideris mit akkurater und umfangreicher Quellenarbeit unterfütterte Studie hebt es unzweideutig hervor: Die aufwändige Handelsdiplomatie der Bourbonen vermochte es letztlich in keiner Weise, die strukturellen Ketten interregionaler Wirtschaftsasymmetrien zu sprengen.