

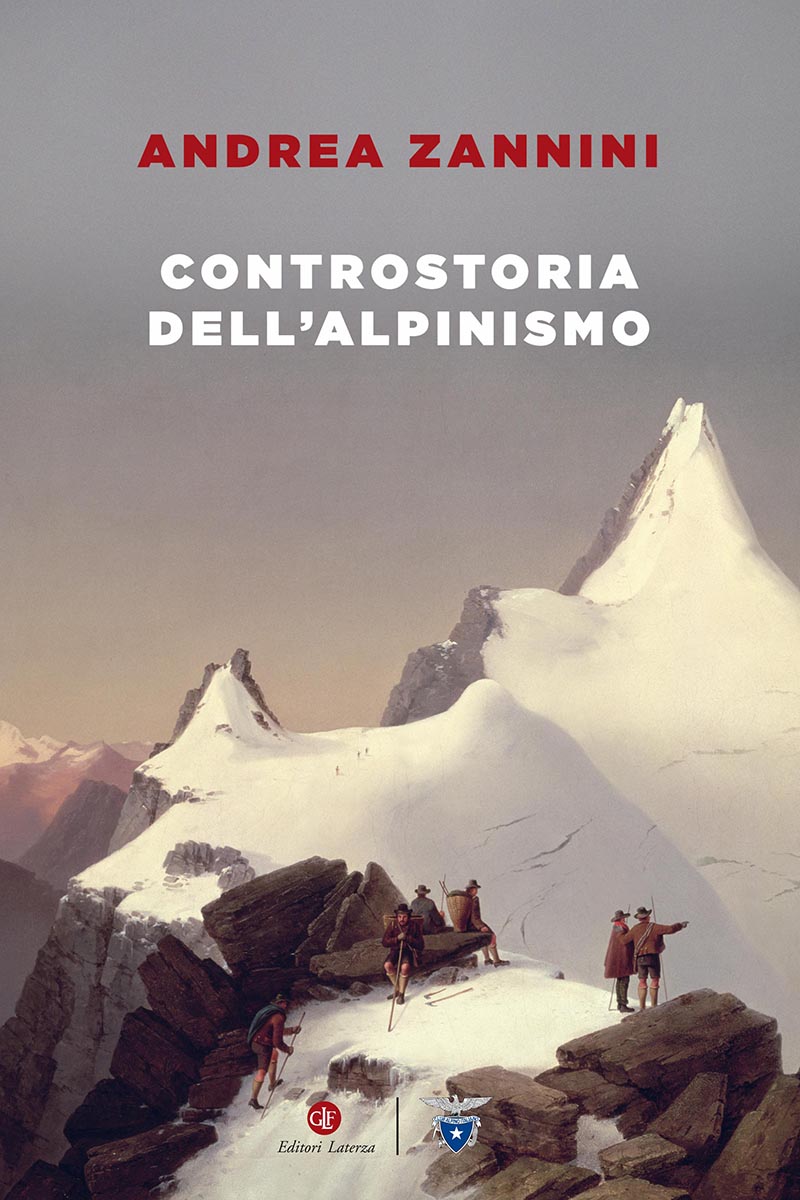
Reviewer Andrea Pojer - Università di Trento | FBK-ISIG
CitationAndrea Zanninis Monografie Controstoria dell’alpinismo lässt sich in mehrerlei Hinsicht einer historiographischen Wende zuordnen, die sich seit einigen Jahren innerhalb der Geschichtsschreibung zu den Alpen und der Gebirgswelt im Allgemeinen vollzieht. Zuletzt wurde nämlich wiederkehrend das Paradigma in Frage gestellt, wonach das Gebirge in vormoderner Zeit weitestgehend negativ wahrgenommen wurde. Das erfolgte einerseits durch Rückgriff auf bisher vernachlässigte Quellen, in denen ein positives Verständnis der Gebirgslandschaft vonseiten frühneuzeitlicher Gesellschaften greifbar wird, als auch durch eine Neukontextualisierung der bereits bekannten Zeugnisse[1]. Die Erkenntnis, dass einige Gipfel bereits schon vor der Entstehung des modernen Alpinismus erklommen wurden, hat inzwischen nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen Verbreitung und Zustimmung gefunden, sondern auch recht schnell ihren Weg aus dem akademischen Elfenbeinturm gefunden[2].
Eine nicht akademische Leserschaft will auch das in der vom Verlag Laterza und dem Club Alpino Italiano (CAI) herausgegebene Reihe Tracce erschienene Buch erreichen, das auf einen klar durchdachten, mitreißenden, teilweise fast erzählerischen Darstellungsduktus zurückgreift. Nichtsdestotrotz bildet die Studie zugleich einen nicht unbedeutenden Beitrag zu der oben skizzierten geschichtswissenschaftlichen Debatte, auf die im ersten Kapitel des Buches eingehend verwiesen wird.
Der Wert von Zanninis Untersuchung liegt dabei nicht so sehr in der Neukontextualisierung einer reichhaltigen Vielfalt an zumeist gedruckten bzw. edierten Quellen, die die alltägliche Begehung des Gebirges in vormoderner Zeit belegen und veranschaulichen, sondern vielmehr in der systematischen Dekonstruktion jener historischen (Selbst)narration, durch die die Alpinisten des ausgehenden 18., vor allem aber des 19. Jahrhunderts die Erstbesteigung und Eroberung der wichtigsten Alpengipfel für sich beansprucht haben. Dies kündigt auch schon der Titel mit seinem programmatischen Begriff der Controstoria an, wobei eine beträchtliche Zeitspanne erfasst wird, die von der Frühen Neuzeit bis in das späte 19. Jahrhundert reicht.
Die These, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch zieht und bereits in der Einleitung präsentiert wird, lautet nämlich, dass das Gebirge nicht im Zuge des 18. Jahrhunderts von Wissenschaftlern oder Romantikern entdeckt wurde, sondern schon lange zuvor von den Alpenbewohnern selbst aus Erholungs- und Freizeitszwecken («loisir») aufgesucht wurde (S. 7). Das Ziel der Studie ist daher eine Geschichte des Alpinismus von unten (S. 8), die sowohl die Wahrnehmung und Erfahrung des Gebirges durch die Lokalbevölkerung aufwerten will, als auch die moderne, bürgerliche und europäische Darstellungsperspektive des klassischen Alpinismus in Frage stellt.
Im ersten Teil der Untersuchung wird daher auf die von der herkömmlichen Geschichtsschreibung weitestgehend vernachlässigten Besucher des Gebirges in vormoderner Zeit eingegangen: Jäger, Kristallsucher, Hirten, Transporteure und Bergarbeiter, die in ihrem Alltagsleben Gipfel und Berghöhen aufsuchten und bestens kannten. Dafür bedienten sie sich bereits jener Ausstattung (Alpenstock, Bergeisen usw.), die Jahrhunderte später von den ersten Alpinisten übernommen und verfeinert werden sollte. Zugleich verweist Zannini dabei auf den historiographisch nicht nebensächlichen Umstand, dass diese alltäglichen Bergbesteigungen meist nur schwer in den Quellen fassbar sind. Da die vormodernen Alpenbewohner kaum schriftliche oder materielle Zeugnisse über diese Gebirgsaufsuchungen hinterlassen oder überliefert haben, muss diese interne Perspektive vor allem anhand der Berichte zumeist externer Alpenbesucher rekonstruiert werden.
Daran anknüpfend präsentieren die darauffolgenden Kapitel mehrere Beispiele für Gipfel, die nachweisbar bereits in präalpinistischer Zeit erklommen wurden. Anstatt sich auf die zum Scheitern verurteilte Versuchung einzulassen, nach der ersten Gebirgsbesteigung überhaupt zu fragen, skizziert Zannini kurz die Breite des Phänomens, indem er auch auf Gipfelaufsuchungen in der Antike oder im frühneuzeitlichen Südamerika verweist. Detaillierter wird dann auf mehrere Besteigungen während der Frühen Neuzeit eingegangen, wobei vor allem auf die Rolle von Geistlichen eingegangen wird, die den Weg für die wissenschaftlich-aufklärerische Gebirgsbegeisterung ab dem 18. Jahrhunderts bahnten. Einige dieser Beispiele gehen dabei auf Zanninis bereits 2004 erschienene Studie mit dem Titel Tonache e piccozze. Il clero e la nascita dell’alpinismo zurück[3].
Ab dem 7. Kapitel verschiebt sich der zeitliche Untersuchungsrahmen von den in voralpinistischer Zeit belegten Gipfelbesteigungen zu jenen, die traditionell den modernen Alpinisten zugeschrieben werden. An der Besteigung des Monte Bianco in den 1770er Jahren, die wiederkehrend als Stern- und Geburtsstunde des Alpinismus gefeiert wurde, veranschaulicht Zannini, wie es von da an den Alpinisten gelang, auf ihre soziale Stellung und mediale Strategien zurückzugreifen, um frühere oder zeitgleiche Erstbesteigungen durch ihre eigenen Exkursionen zu überschatten. Denn obwohl wiederkehrend lokalen Experten als Führer und Träger eine entscheidende Rolle bei diesen Unterfangen zukam, wurde ihr Beitrag zumeist in den veröffentlichten und medial geschickt verzerrten Besteigungsberichten als nebensächlich dargestellt oder gar übergangen, um stattdessen allein die Leistung der auswärtigen, zumeist großbürgerlichen Alpinisten zu feiern, die die Exkursionen finanziert hatten: «che le decine di guide e portatori che contribuirono a tale successo vi applicarono competenze e tecniche note da tempo (corde, ramponi, bastoni ferrati, suole chiodate, scale, asce da ghiaccio); che le società di montagna avevano la cultura, la passione e l’inventiva per coltivare anche il gioco della scoperta e dell’alpinismo: tutto questo, se fosse stato subito certificato da comunicatori del calibro di de Saussure e Bourrit, avrebbe messo su un piede totalmente diverso, sin dall’inizio, la storia della nascita dell’alpinismo […]» (S. 112).
Ausgehend von dieser Erkenntnis zeichnet Zannini die weitere historische und programmatisch-ideologische Entwicklung – ganz im Geiste der -Ismen des 19. Jahrhunderts – des Alpinismus nach. Verwiesen wird dabei auf dessen zunehmende, nicht selten nationalistisch geprägte Institutionalisierung und Verbindung zum aufkommenden Alpentourismus. Zugleich hinterfragt und dekonstruiert er die herkömmliche Narration vieler der bekanntesten alpinistischen Besteigungen des 19. Jahrhunderts. Dabei gelingt es ihm, darzulegen, dass viele dieser Gipfel entweder bereits zuvor durch teilweise namentlich nicht fassbare Alpenbewohner erklommen wurden oder überhaupt nur durch die entscheidende Unterstützung und Expertise der Lokalbevölkerung erreicht werden konnten, der somit eine Schlüsselrolle bei der Durchführung dieser alpinistischen Exkursionen zukam.
In diesem Sinne setzt Zannini auch Francesco Petrarcas bekannte Besteigung des Mont Ventoux nicht an den Anfang seiner Untersuchung, sondern an das Ende. Diese analysiert er nämlich nicht als eines der zahlreichen vormodernen Beispiele für die Anziehungskraft des Gebirges oder gar als Erstbesteigung überhaupt, sondern vielmehr als einen idealen Abschlusspunkt in der Etablierung eines historischen Narrativs, durch das das nationalistische Selbstverständnis des Alpinismus am Ende des 19. Jahrhunderts legitimiert werden sollte. Die Berufung auf den italienischen Humanisten als idealen Gründungsvater deutet er demnach als Versuch, den Prototypen eines elitären, intellektuellen und städtischen Alpinisten zu schaffen, mit dem sich die Mitglieder des neugegründeten CAI identifizieren sollten.
Insgesamt zeichnet sich die Studie durch eine scharfsinnige und vielfältige Neubeleuchtung weitestgehend bekannter Quellen aus. Dass dabei gerade auch von denjenigen Zeugnissen ausgegangen wird, auf die sich die herkömmliche Geschichtsnarration des Alpinismus stützt, untermauert zusätzlich die durchwegs überzeugende Argumentation dieser Controstoria. Es werden zwar nicht alle behandelten Beispiele und Fallstudien einer tiefgreifenden Analyse unterzogen, doch wird dieser Umstand durch die beträchtliche Spannbreite der Untersuchung wettgemacht, die den gesamten Alpenbogen und seine wohl bekanntesten Gipfel abdeckt. Dies spiegelt sich auch in der bearbeiteten Literatur wider, die Publikationen in italienischer, englischer, französischer und deutscher Sprache umfasst. Gerade die Dichte dieser empirischen Basis veranschaulicht umso mehr die Vielfalt der vormodernen und nicht-alpinistischen Gebirgswahrnehmung. Allerdings stützt sich das Buch nicht nur auf eine solide historiographische Untersuchung, sondern auch auf die Expertise des Autors als erfahrener Bergsteiger. Die im Text eingearbeiteten Beobachtungen und Einschätzungen zu den verschiedenen Berg- und Gipfelsteigen stellen in diesem Sinne einen zusätzlichen Mehrwert dar, zumal sie die umwelträumlichen Schwierigkeiten greifbar werden lassen, mit denen viele der behandelten Besteigungen verbunden waren.
Wie bereits einleitend erwähnt, ist es Zannini zudem geglückt, eine Arbeit vorzulegen, die trotz ihres unverkennbaren wissenschaftlichen Werts auch von einem breiteren nicht akademischen Publikum rezipiert werden kann. Dazu mag zweifelsohne auch der stellenweise wohl bewusst provokatorisch angehauchte Sprach- und Argumentationsduktus sowie die thesenhafte Zuspitzung des Buches beitragen. Einige der daraus resultierenden Aussagen dürften zweifelsohne zu weiteren historischen Untersuchungen und Debatten anregen, so etwa die starke Dichotomie zwischen lokalen Alpenbewohnern und auswärtigen Alpinisten oder die in der Einleitung formulierte, im Zuge der Studie aber nicht weiter ausgearbeitete These einer imperialistischen Prägung des Alpinismus und der daraus resultierenden Forderung: «Le Alpi e gli alpigiani si meritano finalmente una storia post-coloniale» (S. 10).
Gerade solche Anstöße zu neuen Untersuchungsperspektiven dürften zusammen mit dem Übersichtscharakter der Studie die besten Voraussetzungen für eine weitläufige Rezeption bilden, die dem Werk hiermit ausdrücklich gewünscht sei.
[1] Verwiesen sei hier vor allem auf: J. Mathieu - Boscani Leoni (Hgg.), Die Alpen! Zur europäischen Wahrnehmungsgeschichte seit der Renaissance / Les Alpes. Pour une histoire de la perception européenne depuis la Renaissance, Bern et al., Peter Lang, 2005; M. Korenjak, Wie Tirol zum Land im Gebirge wurde. Eine Spurensuche in der Frühen Neuzeit, in «Geschichte und Region/Storia e regione», 21, 2012, S. 140-162; M. Korenjak, Why Mountains Matter: Early Modern Roots of a Modern Notion, in «Renaissance Quarterly», 70, 2017, S. 179-219; D.L. Hollis, Mountain Gloom and Mountain Glory: The Genealogy of an Idea, in «ISLE», 26, 2019, S. 1038-1061.
[2] Allein dieses Jahr hat dazu neben der Studie Zannins die für eine breite Leserschaft überarbeitete Dissertation von Dawn L. Hollis beigetragen: D.L. Hollis, Mountains before Mountaineering. The Call of the Peaks before the Modern Age, Cheltenham, The History Press, 2024. Zudem gelangte mit dem Dokumentarfilm von Luca Cococcetta, Monte Corno – Pareva che io fussi in aria, 2024, eine Gipfelbesteigung aus dem 16. Jahrhundert in die Kinosäle.
[3] A. Zannini, Tonache e piccozze. Il clero e la nascita dell’alpinismo, Torino, CDA & Vivalda Editori, 2004.