

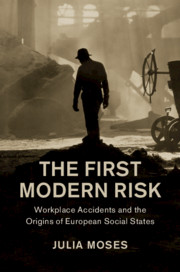
Reviewer Nicole Kramer - Goethe-Universität Frankfurt
CitationDie Anfänge des Sozialstaats waren in den letzten Jahren nur noch selten Gegenstand von geschichtswissenschaftlichen Studien. Freilich ist vieles bereits bekannt: Historiker*innen haben die nationalen Gesetzesdebatten bereits gründlich studiert, Vordenker und zentrale Akteure in den Ministerien beleuchtet und offengelegt, welch disziplinierende wie demokratisierende Kräfte der Alters-, Kranken- und Unfallversicherung innewohnten. Über die ambivalente Haltung der Arbeiterbewegung gegenüber dem «Sozialismus von oben» wissen wir ebenso gut Bescheid, wie über die kommunalen, kirchlichen und genossenschaftlichen Vorläufer der staatlichen Sicherungsprogramme. Hinzukommt, dass sich die historische Wohlfahrtsstaatforschung immer mehr auf die Zeit seit den 1970er Jahre konzentrierte, als die Schar der Kritiker am staatlichen Solidaritätsanspruch und den dazugehörigen Interventionen rasch wuchs.
Julia Moses richtet mit ihrem The First Modern Risk. Workplace Accidents and the Origins of European Social States die Aufmerksamkeit wieder auf die frühen Tage europäischer Sozialstaaten, genauer gesagt auf die Absicherung von Arbeitsunfällen. Moses rückt den Begriff des Risikos in den Mittelpunkt und studiert, wie Zeitgenossen Sicherungsregeln formulierten und implementierten, die das Verhältnis von Staat und Individuum definierten. Sie rekonstruiert auf diese Weise, welche soziale Ordnungsvorstellungen den Gesetzgebungsprozessen sowie den Entscheidungen und Handlungen von Gerichten, Unfallkassen, Arbeitgebern wie Arbeitnehmern zugrundlagen und trägt damit zur aktuell intensiv diskutierten Frage nach den Grundideen, die den Sozialstaat ausmachen, bei. Besonderes Gewicht erlangt ihr Studie dadurch, dass sie das in der historischen Wohlfahrtsstaatsforschung klassische Vergleichspaar Großbritannien und Deutschland um den südeuropäischen Fall Italiens erweitert und, darüber hinaus, die zwischenstaatliche Kommunikation und gegenseitige Beobachtung der Sozialstaatsplaner systematisch miteinbezieht. In sechs Kapitel breitet Moses ihre Argumentation aus und führt die Leserinnen und Leser von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, in dem die Grenzen zwischen Arbeit und Krieg verschwammen, was den Begriff des Risikos veränderte.
Im ersten Kapitel steht im Mittelpunkt, warum Politiker in drei Ländern, die was den Grad der Industrialisierung und Nationalstaatsbildung anbelangte, teils weit auseinanderlagen, Handlungsbedarf in Sachen Arbeitsunfälle erkannten. Statistiken legten nahe, dass Letztere in manchen Branchen zum Arbeitsprozess dazugehörten und unabwendbar waren. In allen drei Ländern zogen Politiker die bisherigen juristischen Möglichkeiten, individuelle Haftungspflichten vor Gericht festzustellen, in Zweifel, je mehr sich die Einsicht verbreitete, dass Unfälle nicht von Einzelnen verschuldet waren. In Deutschland setzten sich Befürworter einer Pflichtversicherungslösung durch. Die Einführung der Sozialversicherungen sollte der Industrialisierung dienen, Politikern unterschiedlicher Couleur gefiel aber auch der Gedanke, dass sich der noch junge Nationalstaat damit als Pionier der Sozialstaatsentwicklung hervortat. Die Notwendigkeit die Macht des neuen Leviathans durch die sozialpolitischen Aufgaben zu legitimieren, spielte eine wichtige Rolle für die Verabschiedung der Gesetze. Die Sicherung des Risikos von Betriebsunfällen lässt sich indes nicht allein machtpolitisch erklären, das zeigt vor allem das britische Beispiel. Der Workmen’s Compensation Act von 1897 sicherte den britischen Arbeiterinnen und Arbeitern das Recht im Falle eines Arbeitsunfalls, finanzielle Leistungen zu erhalten. Die Durchführung oblag jedoch weiterhin den Gerichten, die über Haftpflichtansprüche entschieden oder aber privatwirtschaftlichen Versicherungen und genossenschaftlichen Vereinigungen. Und was war mit Italien? Hier, wo die Industrialisierung zwar weit weniger vorangeschritten war, als in Großbritannien oder Deutschland, fanden ähnliche Diskussionen wie in anderen europäischen Ländern statt, die Situation zugunsten der Arbeiter zu verändern. Die auf Vorschlag des liberalen Politiker Luigi Luzzattis 1883 eingerichtete nationale Unfallkasse, brachte noch keinen grundlegenden Wandel, denn nur wenige nutzten die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung (1897 waren es etwa 173.000). Erst 1898 entschiedenen sich die Regierenden in Rom angelehnt am deutschen Vorbild, eine Unfallversicherung einzuführen, auch weil sie diese als Muss moderner Staatstechnik betrachteten.
Wie sich die neuen Gesetze in den sozialpolitischen Architekturen der Länder niederschlugen, ist der Kern des dritten Kapitels. In Großbritannien änderte sich wenig, blickt man allein auf die Verwaltungsstrukturen. Whitehall hatte zwar die grundlegenden Regeln verändert, aber die Aufsicht über die Umsetzung der Absicherung den bisherigen Akteuren überlassen. Ganz anders sah die Situation im Deutschen Reich aus. Das 1884 neugeschaffene Reichsversicherungsamt verkörperte eindrucksvoll den staatlichen Aufgabenzuwachs. Wenngleich eine solche Zentralstelle in Italien fehlte, stärkte die Regierung in Rom ebenfalls die Rolle des Staates als Schutzinstanz. Insbesondere die regelmäßig durchgeführten Inspektionen, denen Arbeitgeber die Tore ihrer Betriebe öffnen mussten, griffen für alle sichtbar in die Arbeitsbeziehungen ein.
Die Sozialgesetzgebung griff tief in das gesellschaftliche Gefüge ein, das wird im vierten Kapitel deutlich, wo herausgearbeitet wird, wie sich die gesellschaftlichen Ansprüche an die Eigenverantwortung von Arbeiter*innen bzw. an die Kollektivverantwortung veränderten. Die Zahl der Arbeitsunfälle stieg in den Jahren nach den gesetzlichen Reformen in allen drei Ländern sprunghaft an. Gerichte und Unfallversicherungsträger erkannten immer mehr Fälle an, in denen Betroffene Leistungen in Anspruch nehmen konnten. Sie zogen jedoch eine klare Grenze, wenn es um Berufskrankheiten ging, denn die waren nicht Ergebnis eines plötzlichen Ereignisses, sondern einer schleichenden Beeinträchtigung der Gesundheit. Die Geschichte der Absicherung von Betriebsunfällen ist eben keine von linear wachsender Staatsverantwortung. Die Gegenbewegungen zeigen sich indes beispielsweise dort, wo Experten auf nationaler Ebene und auf internationalen Kongressen über das Problem des Leistungsmissbrauchs debattierten. Bestimmungen gegen vermeintliche Simulanten und «Rentenneurotiker» spiegelten, so Moses, wie sehr die Vorstellung der Eigenverantwortung und individuellen Schuld von Arbeiter*innen nach wie vor Sozialpolitik bestimmte.
Dass die Ausweitung der Sozialgesetzgebung keinem Automatismus folgte, wird im fünften Kapitel vertieft. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, stellten sich die nationalen Regierungen immer wieder die Frage, welche Gruppen das Recht auf soziale Sicherung im Falle eines Betriebsunfalls haben sollte und welche nicht. Sie fanden recht unterschiedliche Antworten. Machte der britische Sozialstaat vor den Toren der Kolonien halt, nutzte der italienischen Regierung die Unfallversicherung, um ihren Herrschaftsanspruch außerhalb des Mutterlandes gelten zu machen. Allerdings waren im überwiegend agrarisch geprägten Mittelmeerstaat die landwirtschaftlichen Arbeiterinnen und Arbeiter bis 1917 von diesem Zweig der Sozialversicherung ausgeschlossen. Doch was lässt sich aus solchen Unterschieden rauslesen? Regierende in Italien, Deutschland und Großbritannien pflegten eine spezifische Form von Sozialstaatlichkeit, die sie durch neue Bestimmungen über Anspruchsberechtigungen bekräftigten. In Worten und Bildern präsentierten sie diese zudem auf Kongressen, in Ausstellungen und mit Hilfe von Schullehrmaterialien, um die Idee des Sozialstaats an den Mann, die Frau und das Kind zu bringen.
Mit dem letzten Kapitel spannt Moses den Bogen zum Ersten Weltkrieg, als die jeweiligen Regierungen mehr Ressourcen denn je darauf verwandten, den Arbeitsschutz zu stärken und Arbeiter*innen entsprechend zu unterweisen. In Zeiten also, in denen die kriegführenden Nationen die nationale Gemeinschaft beschworen, fand eine Rückbesinnung auf die Eigenverantwortung der Einzelnen statt, kommentiert Moses.
The First Modern Risk ist kein einfach zu lesendes Buch, u.a. deswegen, weil es einer problemorientierten Systematik folgt und sich der Dreiländervergleich quer durch (fast) alle Abschnitte zieht. Zudem bündeln manche der sechs Großkapitel bisweilen Themen, deren Zusammenhang sich nicht ohne Weiteres erschließt. Immer wieder sind konkrete Einzelfälle von klagenden Arbeiter*innen oder solchen, denen Versicherungsleistungen verweigert wurden, eingeschoben, was die Erzählung belebt, aber mehr illustrativen als analytischen Wert hat. Die Autorin demonstriert allerdings gekonnt, dass eine komparative Studie die Transfergeschichte nicht automatisch ausschließt. Ganz im Gegenteil kann sie mit ihrem Zugriff zeigen, inwieweit das auf internationalen Kongressen Besprochene Eingang in die nationale Gesetzgebung findet. Sie kommt dabei zum Ergebnis, dass die grenzübergreifende Zirkulation von Ideen dann ihre Bedeutung verlor, als die jeweiligen Länderregierungen sich für ein Modell der Absicherung von Arbeitsunfällen entschieden hatten und dieses als das ihnen eigene propagierten.
Die Studie ist ein Beitrag zur Ideengeschichte der Sozialpolitik, die sich nicht auf die kleine Elite von Vordenkern und auf einen engen Kreis von Schlüsseltexten beschränkt. Moses führt uns vor Augen, dass in den bisweilen technisch anmuteten Auseinandersetzungen über Beitragspflichten, Anspruchsberechtigungen und Leistungsberechnungen, letztlich über Menschenbilder und soziale Ordnungsideen verhandelt wurde. Es sind die Vielzahl administrativer Entscheidungen und die fein verästelten Steuerungsstrukturen, die es zu beleuchten gilt, will man die Dynamik der Sozialgesetzgebung Ende des 19. Jahrhunderts verstehen. Die Dialektik von sozialstaatlicher und damit kollektiver Absicherung einerseits und der Eigenverantwortung Einzelner andererseits war einer ihrer zentralen Drehmomente.